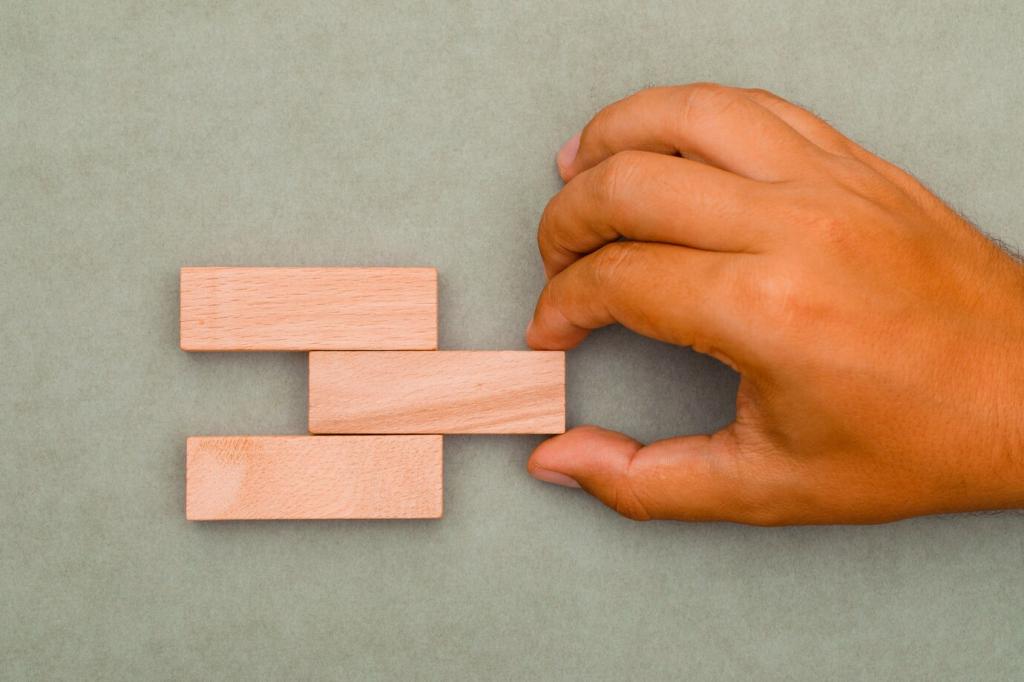Definitionen und Denkweisen: Worum geht es wirklich?
Low‑Code bietet visuelle Modellierung mit der Möglichkeit, Logik und Integrationen per Code zu verfeinern. Ideal, wenn Anforderungen komplex sind, Schnittstellen entscheidend werden und professionelle Entwickler eng mit Fachbereichen zusammenarbeiten möchten.
Definitionen und Denkweisen: Worum geht es wirklich?
No‑Code ermöglicht Fachanwenderinnen und Fachanwendern, Lösungen ohne Programmierung zu erstellen. Perfekt für Workflows, Formulare und Datenansichten, die schnell entstehen sollen, solange man innerhalb der vorgegebenen Bausteine und Plattform‑Limits bleibt.